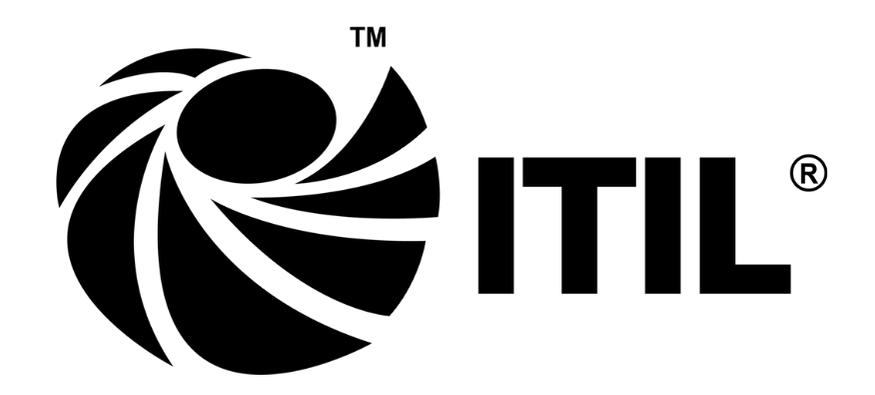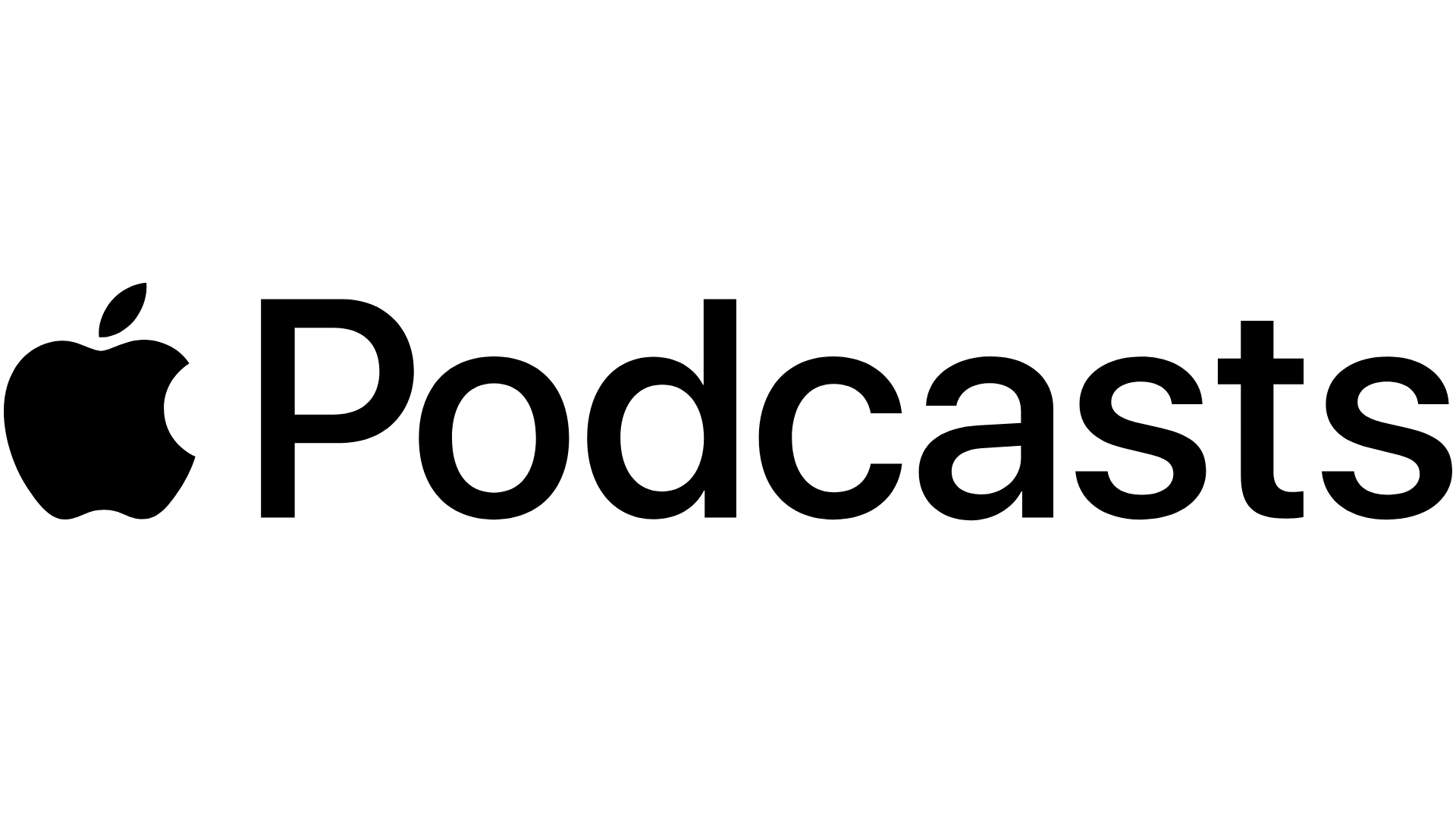Und wie Venture Clienting eine praktische Lösung bietet.
Unternehmensinnovationen sind oft voll von guten Absichten, Visionen und grossen Hoffnungen. Aber meistens kommen die Bemühungen zum Stillstand, bevor sie etwas Wirkliches hervorbringen. Die Schlagworte sind da: "Labs", "Accelerators", "Proofs of Concept", aber greifbare Ergebnisse?
Selten.
Warum scheitern also so viele Innovationsinitiativen von Unternehmen, bevor sie überhaupt begonnen haben?
Laut Dr. Philipp Gneiting, Leiter der Abteilung Open Innovation bei Mercedes-Benz, liegt das Problem nicht in einem Mangel an Ideen oder Start-ups. Das eigentliche Problem ist ein Mangel an Engagement für die Lösung tatsächlicher Geschäftsprobleme. In dieser Folge des TEQ Shift Podcasts erklärt er, woran es hapert - und wie ein Venture-Clienting-Modell Abhilfe schaffen kann.
1. Die Illusion der Innovation
Viele Unternehmen behandeln Innovation wie Theater. Sie inszenieren eine Show: Startup-Demos, Pitches, Visionen, aber was fehlt, ist die operative Umsetzung.

"Wenn es keinen definierten Anwendungsfall oder kein Budget gibt, ist es Innovationstheater".
-Dr. Philipp Gneiting
Ohne einen klaren Geschäftsbedarf bleiben Startups in endlosen Diskussionsrunden, Pilotprojekten und Sandkastenumgebungen stecken, die nie zu einem realen Einsatz führen. Das ist Innovation um der Optik willen.
2. Proof of Concept ≠ Wertnachweis (Proof of Value)
Die gängige Meinung ist, dass ein erfolgreicher POC automatisch zu einer Übernahme führen wird. In Wirklichkeit kommen die meisten POCs nicht über den ersten Test hinaus.
Und warum? Weil es keine nachgelagerte Verpflichtung gibt.
"Wir führen oft einen POC durch, ohne zu wissen, was als nächstes kommt. Das ist eine Verschwendung von Zeit für alle Beteiligten.
Um das POC-Fegefeuer zu überwinden, müssen Unternehmen die Innovation direkt mit einem Nutzen verbinden: Kostenreduzierung, Risikominderung, Geschwindigkeit oder Qualität. Die Technologie sollte nicht nur funktionieren, sie muss auch für andere funktionieren .
3. Der wahre Engpass: Interne Ausrichtung
Innovation scheitert nicht, weil Startups zu wenig leisten. Sie scheitern, weil die Unternehmen nicht wissen, wie sie sie aufnehmen sollen.
Philipp erklärt, dass ohne Budgetverantwortung, einen engagierten internen Sponsor und einen klaren Zeitplan für die Integration, selbst die beste Startup-Lösung scheitern wird.
Unternehmensteams unterschätzen oft, wie schwierig es ist, interne Systeme, Prozesse und Verantwortlichkeiten anzupassen. Hier sterben die meisten Pilotprojekte im Stillen.
4. Venture Clienting: Ein ehrlicheres Modell
Venture Clienting kehrt das Drehbuch um. Anstatt in Start-ups zu investieren oder Innovationslabors zu veranstalten, wird das Unternehmen zu einem frühen, ernsthaften Kunden.
Was ändert sich?
-
Das Start-up entwickelt eine Lösung für ein echtes Geschäftsproblem.
-
Das Unternehmen stellt ein echtes Budget zur Verfügung.
-
Das Engagement ist kurz, praktisch und ergebnisorientiert.
"Du investiest nicht in das Startup. Man kauft von ihnen. Das macht den Unterschied aus."
Dieser Ansatz beseitigt die Unklarheiten. Jeder kennt die Regeln. Startups bekommen einen zahlenden Kunden. Unternehmen erhalten eine funktionierende Software.
5. Die Zeit bis zur Wertschöpfung ist die einzige Metrik, die zählt
In der Risikokundenbetreuung geht es nicht nur darum, Dinge schnell zu erledigen - es geht darum, die richtigen Dinge schnell zu erledigen .
Von der ersten Besprechung bis zur Bereitstellung ist der Zeitplan komprimiert, aber strukturiert. Der Geschäftswert ist der Polarstern. Keine Pitch-Wettbewerbe. Keine dreijährigen Innovationszyklen.
"Innovation ist kein Trichter. Sie ist ein Filter. Du benötigst nicht mehr Ideen. Du benötigst mehr Klarheit."
Letzter Gedanke
Wenn du Innovation wirklich willst, solltest du aufhören, sie wie ein Theater zu verwalten. Höre auf, Ideen zu jagen, und beginne, echte Probleme zu lösen.
Wie Philipp Gneiting es ausdrückt: Die Lösung liegt nicht in mehr Innovation. Es ist eine bessere Ausrichtung des Unternehmens. Das ist es, was Venture Clienting ermöglicht - eine Möglichkeit, Startups und Unternehmen durch gemeinsame Ergebnisse zu verbinden, nicht durch gemeinsame Präsentationen.