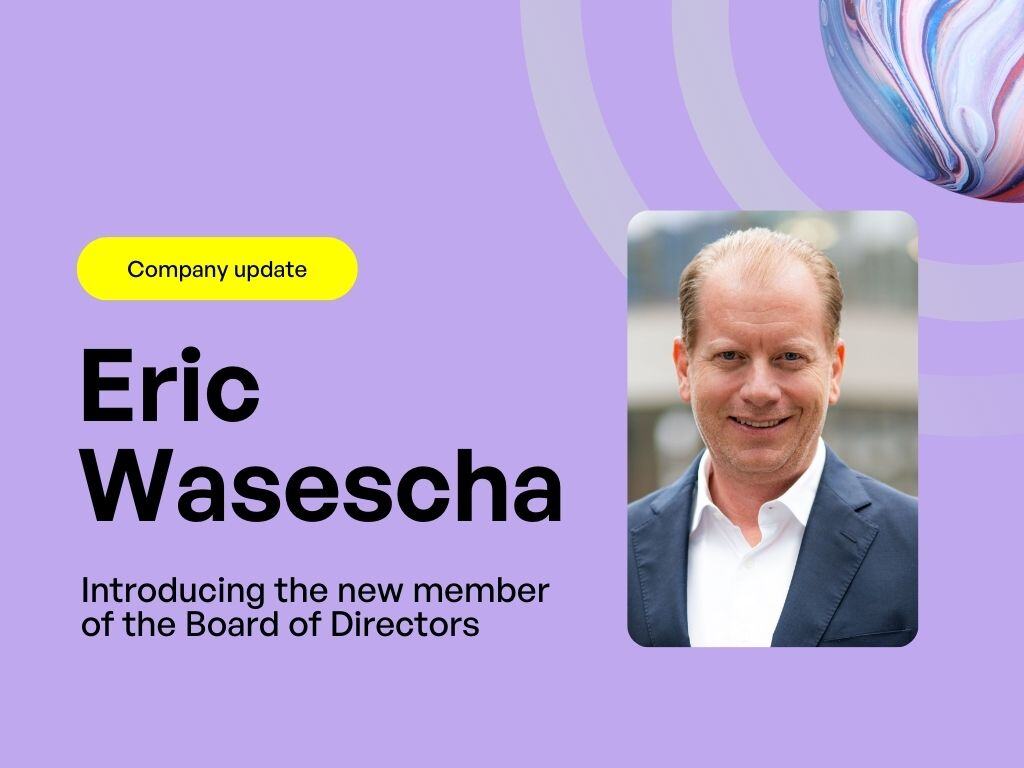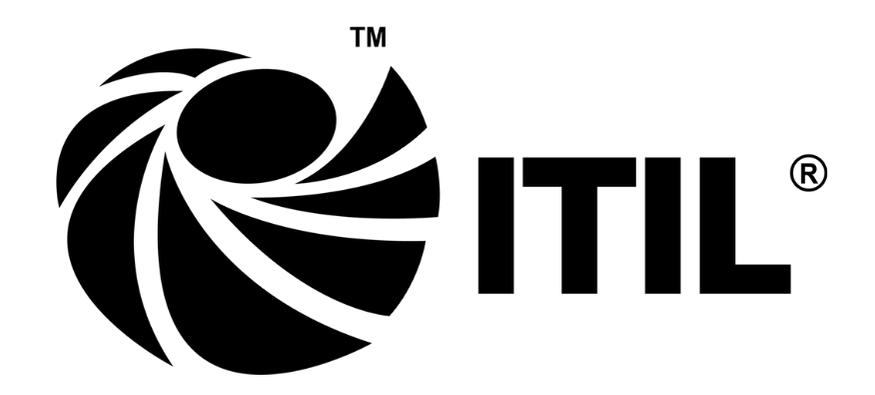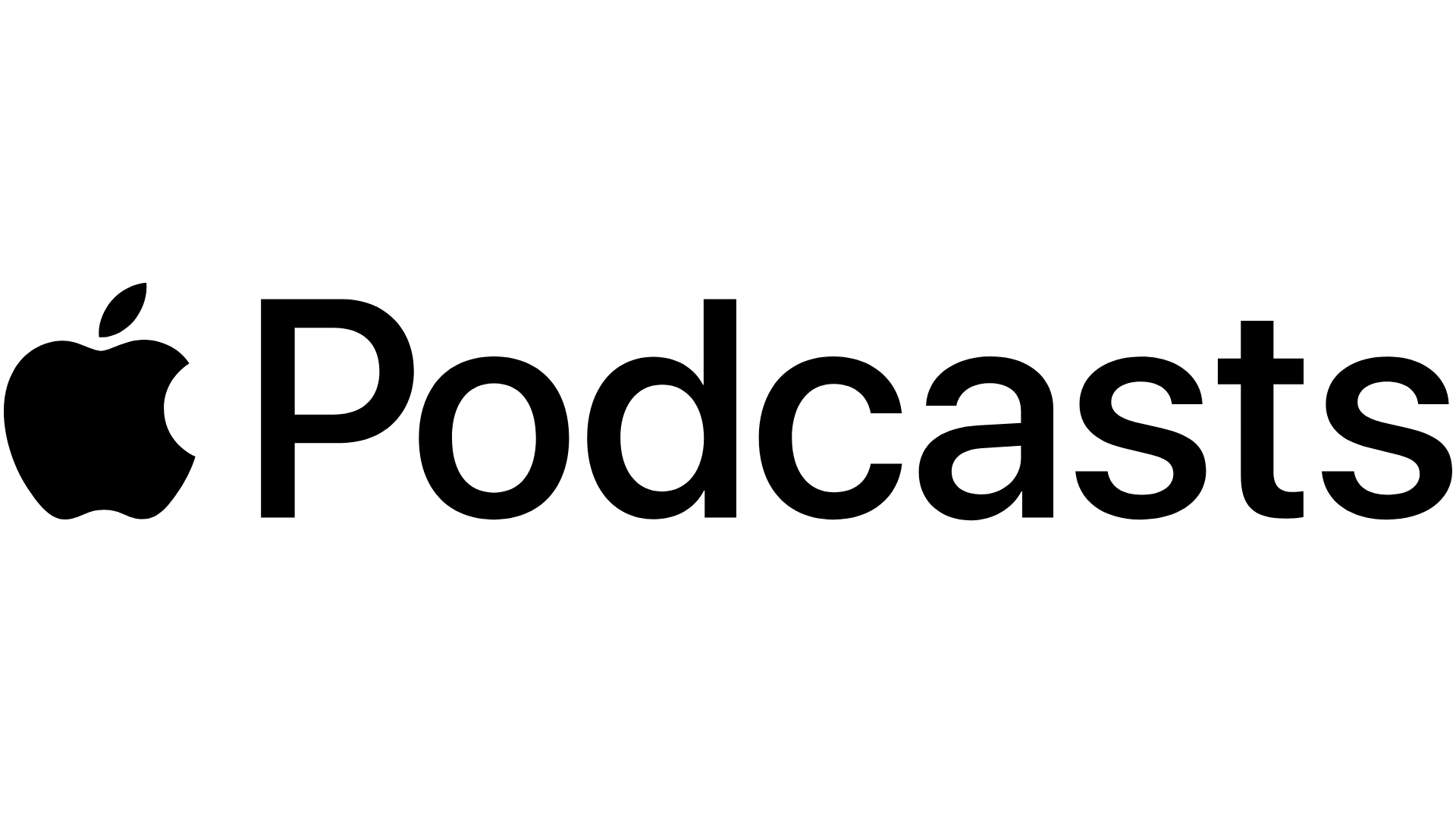Den Monolithen durchbrechen
Jahrzehntelang haben sich Unternehmen auf monolithische Systeme verlassen, um ihren Betrieb zu gewährleisten. Diese Systeme waren stabil, vorhersehbar und oft tief in die Struktur des Unternehmens integriert. Doch heute, in einer Ära, die von Agilität, ständigem Wandel und künstlicher Intelligenz (KI) geprägt ist, sind monolithische Systeme eher eine Einschränkung als eine Erleichterung.
Die ereignisgesteuerte Architektur (EDA) zeichnet sich als Lösung ab. Durch die Aufteilung von Systemen in modulare, ereignisgesteuerte Komponenten können Unternehmen die Reaktionsfähigkeit in Echtzeit, die nahtlose Integration und die Flexibilität bei der Skalierung nutzen. In diesem Artikel gehen wir der Frage nach, warum monolithische Systeme die Innovation bremsen, warum EDA im Zeitalter der KI unverzichtbar ist und wie Führungskräfte den Übergang schaffen können, ohne ihre Teams zu überfordern.
Warum Monolithen Unternehmen bremsen
Monolithische Systeme fassen Logik, Daten und Prozesse in einer einzigen, eng gekoppelten Struktur zusammen. Dies vereinfacht zwar die frühe Entwicklung, führt aber im Laufe der Zeit zu erheblichen Herausforderungen:
-
Mangelnde Agilität: Bei jeder Aktualisierung besteht die Gefahr, dass das gesamte System beschädigt wird, was Änderungen langsam und teuer macht.
-
Skalierungsbeschränkungen: Die Skalierung erfordert die Duplizierung des gesamten Systems, nicht nur des Teils, der unter Last steht.
-
Innovationsengpässe: Die Integration neuer Tools oder Technologien (z. B. KI-Dienste) erfordert häufig eine kostspielige Überarbeitung des alten Codes.
-
Chaos der Abhängigkeiten: Teams werden blockiert, weil sie auf die Fertigstellung von Änderungen durch andere warten müssen, bevor sie weiterarbeiten können.
Wie Alexander Martens im TEQ Shift-Podcast hervorgehoben hat, sind Monolithen schlecht für das Tempo moderner Unternehmen geeignet, in denen Innovationszyklen in Wochen und nicht in Jahren gemessen werden.
Das Argument für ereignisgesteuerte Architektur
EDA führt zu einem Paradigmenwechsel, indem sie Systeme in modulare Dienste entkoppelt, die über Ereignisse kommunizieren. Anstelle einer sequenziellen Verarbeitung reagieren die Systeme in Echtzeit auf Ereignisse.
Die wichtigsten Vorteile:
-
Agilität in grossem Massstab: Teams können Komponenten unabhängig voneinander entwickeln, bereitstellen und aktualisieren.
-
Reaktionsfähigkeit in Echtzeit: Daten und Erkenntnisse fliessen sofort und unterstützen proaktive Entscheidungen.
-
KI-Integration: Ereignisströme liefern die Datenpipelines, die KI-Systeme für einen effektiven Betrieb benötigen.
-
Ausfallsicherheit: Ausfälle eines Dienstes führen nicht zum Ausfall des gesamten Systems.
In der KI-Ära, in der Modelle von kontinuierlichen Daten abhängen und Unternehmen dynamisch auf Veränderungen reagieren müssen, ist EDA nicht nur von Vorteil, sondern unerlässlich.
Häufige Fallstricke bei der Umstellung
Obwohl die Vorteile auf der Hand liegen, ist der Übergang von Monolithen zu EDA nicht ohne Herausforderungen. Führungskräfte stolpern oft über:
-
Integrationskomplexität: Die Verknüpfung Dutzender modularer Dienste kann zu unerwarteten Abhängigkeiten führen, wenn sie nicht sorgfältig geplant wird.
-
Lücken in der Steuerung: Ohne angemessene Aufsicht vermehren sich die Dienste unkontrolliert und schaffen eine neue Form des Chaos.
-
Kulturelle Widerstände: Teams, die an eine monolithische Entwicklung gewöhnt sind, haben möglicherweise Schwierigkeiten, sich an die dezentrale Verantwortung anzupassen.
-
Unterschätzung des Änderungsmanagements: Bei der Umstellung auf EDA geht es ebenso sehr um Menschen und Prozesse wie um Technologie.
Fünf Hacks für eine schrittweise Einführung
1. Beginne an den Rändern
Versuche nicht, alles komplett umzuschreiben. Identifiziere kundenorientierte Prozesse oder Dienste, die Flexibilität erfordern (z. B. mobile Anwendungen, digitale Kanäle), und stellen Sie diese zuerst um.
2. Führe einen Event Broker ein
Verwende einen zentralisierten Event Broker (wie Kafka, Pulsar oder Cloud-native Alternativen), um die Kommunikation zwischen den Diensten zu verwalten. Dies gewährleistet Skalierbarkeit und Konsistenz.
3. Priorisiere klare Verträge
Definiere frühzeitig Ereignisschemata und Schnittstellen. Eine konsistente Kommunikation zwischen den Diensten verhindert nachgelagerte Probleme.
4. Frühzeitige Einführung der Überwachung
Echtzeitsysteme erfordern eine Beobachtbarkeit in Echtzeit. Investiere in Tools zur Überwachung von Ereignisflüssen, zur Erkennung von Anomalien und zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit.
5. Aufbau funktionsübergreifender Teams
Ermächtige Teams mit End-to-End-Verantwortung für Dienste. Dies reduziert Abhängigkeiten und beschleunigt die Bereitstellung.
Die Rolle der Führung bei der Förderung von EDA
Führungskräfte spielen eine entscheidende Rolle für das Funktionieren der EDA. Zu ihren Aufgaben gehören:
-
Sie geben die Vision vor, warum modulares, ereignisgesteuertes Design wichtig ist.
-
Zuweisung von Ressourcen für Schulung und Änderungsmanagement.
-
Sicherstellung der Abstimmung zwischen Geschäfts- und Technologieteams.
-
Förderung erster Erfolge, um Dynamik und Vertrauen zu schaffen.
Wie Martens betonte, besteht der Erfolg nicht darin, sich Hals über Kopf in eine neue Architektur zu stürzen. Es geht darum, Ehrgeiz und Pragmatismus in Einklang zu bringen und den Monolithen Stück für Stück aufzubrechen.
Fazit
Das Aufbrechen des Monolithen ist nicht nur eine technische, sondern auch eine strategische Entscheidung. Durch die Einführung einer ereignisgesteuerten Architektur können Unternehmen ihre Agilität steigern, die KI-Integration skalieren und ihre Systeme zukunftssicher machen. Die Umstellung erfordert eine durchdachte Planung, einen kulturellen Wandel und eine starke Führung, aber die Vorteile liegen auf der Hand: ein Unternehmen, das sich anpassen, innovieren und im Zeitalter der KI florieren kann.